Nach jahrzehntelanger Forschung konnten Wissenschaftler bestätigen, dass ein molekulares Protein mit Alterung und einer ganzen Reihe von degenerativen Erkrankungen in Zusammenhang steht.
Die Klotho-Proteine (Alpha und Beta), die noch nicht allgemein bekannt sind, erlangten erstmals in Zusammenhang mit klinischen Studien an Mäusen Berühmtheit. Den Wissenschaftlern war aufgefallen, dass die Lebensspannen von Mäusen mit einem geringen Klotho-Spiegel kürzer waren. Weitere Analysen förderten Wachstumsstörungen, Nierenerkrankungen, Hyperphosphatämie, Hyperkalzämie, Gefäßverkalkungen, kardiale Hypertrophie, Hypertonie, Lungenerkrankungen, kognitive Störungen, multiple Organatrophie und Fibrose zutage.
Diese schockierende Erkenntnis mündete in neue Untersuchungen, im Rahmen derer sich herausstellte, dass Mäuse mit einem hohen Klotho-Wert nicht nur länger lebten, sondern auch eine höhere Lebensqualität genossen und nicht für die vorgenannten degenerativen Krankheiten anfällig waren (Hu et al., 2015).
Das Interesse an diesem Molekül sprang bald auf Studien mit menschlichen Probanden über. Diese Studien zeigten auf, dass das Klotho-Molekül in Fällen von menschlichem Brustkrebs über tumorsuppressive Eigenschaften verfügt (Ligumsky et al., 2015).
Genforscher fanden heraus, dass beim Menschen der Klotho-Spiegel mit dem Alter sinkt und ihn für chronische Nierenerkrankungen, Diabetes, Alzheimer und andere Gesundheitsstörungen anfällig macht. Eine national repräsentative Studie an erwachsenen Amerikanern ergab, dass die Sterberate bei Krankheiten aller Art höher war, wenn die betreffenden Personen einen niedrigen Klotho-Spiegel aufwiesen (Kresovich et al., 2022).
Auch bei übergewichtigen Menschen und ebenso bei Bewohnern von Altersheimen mit kognitiven Beeinträchtigungen, die oft stürzten, konnten niedrige Klotho-Werte festgestellt werden (Sanz et al., 2021).
Ein höherer Klotho-Spiegel in der zerebrospinalen Flüssigkeit korreliert mit einer besseren kognitiven Funktion (Kundu et al., 2022). Wie mittlerweile überzeugend nachgewiesen wurde, ist Klotho der geheimnisvolle Schlüssel, der die Tür zur Entwicklung neuer therapeutischer Konzepte öffnet, welche darauf abzielen, alle mit dem Alterungsprozess verbundenen Fallstricke zu vermeiden.
Klotho erklärt
Bei Klotho handelt es sich um ein Typ-1-Membranprotein, das sich aus 1.012 Aminosäuren zusammensetzt und hauptsächlich in den Nieren, aber ebenso im Gehirn, in der Bauchspeicheldrüse und in anderen Geweben gebildet wird. Das auch als endokrines Hormon (S-Klotho) bekannte Protein ist für den Fibroblasten-Wachstumsfaktor 23 (FGF23) verantwortlich. Tatsächlich stehen die Alterung und letztlich die Verschlechterung der Nierenfunktion in direktem Zusammenhang mit einem niedrigen Klotho-Spiegel und einem Mangel an dem Fibroblasten-Wachstumsfaktor 23. Wie sich herausstellte, beschleunigt ein beschädigtes Klotho-FGF23-System die Alterung. FGF23 wird in den Knochen gebildet und reguliert die Ausscheidung von Phosphat aus der Niere und die Verstoffwechslung von Vitamin D. Ein Mangel an Klotho und dem zugehörigen Fibroblasten-Wachstumsfaktor 23 (FGF23) führt schließlich zu Hyperphosphatämie (Kuro et al., 2018).
Als Hyperphosphatämie wird ein Zustand bezeichnet, bei dem sich zu viel Phosphat im Blut befindet, weil die Filterfunktion der Nieren beeinträchtigt ist. Dies weist oft auf eine chronische Nierenerkrankung hin (CKD). Hyperphosphatämie kann auch andere Erkrankungen auslösen, beispielsweise respiratorische Azidose, die für chronische Lungenentzündungen, Rippenfellentzündungen und Bronchiektasie anfällig macht. Bei etwa 70 Prozent der Patienten, die an fortgeschrittenen chronischen Nierenerkrankungen leiden, liegt Hyperphosphatämie vor. Erhöhte Phosphatwerte im Blut weisen auch darauf hin, dass nicht genug Phosphat in den Knochen vorhanden ist (Hypokalzämie), was zu Osteoporose oder Kalkablagerungen in den Venen, den Augen, der Lunge oder dem Herzen führen kann. Solche Zustände können das Risiko von Herzinfarkten und Schlaganfällen erhöhen (Wang et al., 2022).
Die folgenden Symptome sind für Hypokalzämie typisch: Muskelkrämpfe, brüchige Nägel, trockene Haut, anormal grobes Haar, Gedächtnisprobleme, Reizbarkeit, Kribbelgefühl in den Lippen, auf der Zunge, in den Fingern und/oder in den Füßen, Krampfanfälle und Herzrhythmus-Anomalien (Arrhythmie).
Ernährungsempfehlungen zur Verbesserung des Klotho-Spiegels
Stark phosphathaltige Lebensmittel sind zu vermeiden. Dazu gehören beispielsweise: Milch und Milchprodukte, verarbeitete Käse- und Joghurtprodukte, Limonaden, verarbeitete Fleischwaren, Fast Food, Snacks, Nüsse und Vollkornsaaten wie Weizen, Hafer, Reis, Bohnen und Linsen.
Auch eine kohlenhydratarme, proteinreiche Ernährung verbessert den Klotho-Spiegel (Paquette et al., 2023). Die moderne Wissenschaft hat die Hypothese des australischen Farmers Percy Watson bestätigt, dem schon vor Jahrzehnten aufgefallen war, dass Nutztiere, wenn sie Phosphaten ausgesetzt werden, leichter erkranken und kürzer leben. Percy Watson experimentierte mit Mineralien, um Menschen und Tieren zu helfen, die erkrankt waren, nachdem sie Phosphaten ausgesetzt worden waren. Er entwickelte „Percy’s Powder“, eine Mixtur aus verschiedenen Mineralien in sulfatgebundener Form. Dass Percy lebte, was er predigte, trug natürlich zu seiner Glaubwürdigkeit bei. Er wurde über 100 Jahre alt. Percy’s Powder ist auch heute noch erhältlich und wird häufig von Naturheilkundlern empfohlen.
Nikotinsäure bindet Klotho
Wie eine kürzlich durchgeführte Studie ergab, stabilisiert Nikotinsäure den Klotho-Spiegel und hilft bei rhabdomyolyse-induzierten akuten Nierenschädigungen. Rhabdomyolyse ist eine Erkrankung, die zum Zerfall und zur Zersetzung von Muskelgewebe führt. Dadurch gelangen toxische Elemente aus den Muskelfasern in das Kreislaufsystem und in die Nieren und können dort zu Nierenschädigungen führen (Lin et al., 2021).
Klotho hemmt vier Wege der Alterung
- Der transformierende Wachstumsfaktorβ(TGF-β) reguliert die Bildung von T-Zellen, die Toleranz gegenüber Eigen-Antigenen sowie die Differenzierung von T-Zellen. Er kann sowohl unmittelbar auf die T-Lymphozyten einwirken als auch mittelbar die Funktion von antigenpräsentierenden Zellen regulieren.

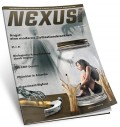
 Das Membranprotein Klotho steht im Rampenlicht der Altersforschung: Niedrige Spiegel sind mit kürzerer Lebensdauer, Nierenerkrankungen, Demenz und Krebs assoziiert, hohe Werte mit Langlebigkeit und dem Schutz vor altersbedingten und degenerativen Krankheiten.
Das Membranprotein Klotho steht im Rampenlicht der Altersforschung: Niedrige Spiegel sind mit kürzerer Lebensdauer, Nierenerkrankungen, Demenz und Krebs assoziiert, hohe Werte mit Langlebigkeit und dem Schutz vor altersbedingten und degenerativen Krankheiten.
Kommentar schreiben