m Mittelalter stellten sich die Bewohner vieler Länder vor, dass irgendwo in der Ferne tatsächlich mystische Ungeheuer existierten. Zum Beispiel glaubten die Geografen und Kartografen Westeuropas, dass es im Osten ein riesiges Gebiet namens Große Tartarei oder Tartarien gab. Beide Namen werden in diesem Artikel verwendet. Angeblich entspringt dort der Fluss der Toten, und die Bewohner dieses Landes werden eines Tages allen das Ende der Welt verkünden.
Wo befand sich dieses mystische Land? Die Große Tartarei ist ein geografischer Begriff, der hauptsächlich von westeuropäischen Wissenschaftlern verwendet wurde. Zwischen dem 12. und 19. Jahrhundert verorteten sie diesen Staat in verschiedenen Teilen Asiens: vom Ural und Sibirien bis zur Mongolei und China. Einige Kartografen glaubten, dass dies der Name für alle Länder war, die von Vertretern der katholischen Welt noch nicht erforscht worden waren. Und dann dehnten sich die Grenzen der Tartarei vom Kaspischen Meer bis zum Pazifischen Ozean aus. Andere Wissenschaftler verbanden dieses geheimnisvolle Land mit Turkestan oder der Mongolei.
Der Name findet sich erstmals in den Schriften des Rabbiners von Navarra, Benjamin von Tudela, um 1173 n. Chr. Er schrieb über die Tartarei und nannte sie die tibetische Provinz. Dieser jüdischen religiösen Figur zufolge lag das Land nördlich von Mogulistan in Richtung des Landes der Tanguten und Turkestans. Einige Wissenschaftler führen den Ursprung des Toponyms „Tartarien“ bzw. „Tartaria“ auf die Vermischung von zwei Begriffen zurück: dem altgriechischen Tartaros und dem Namen des Volkes „Tataren“. Es wird angenommen, dass diese Wörter in den Köpfen der Bewohner Westeuropas wegen der klanglichen Ähnlichkeit zusammengesetzt wurden.
Tatsächlich hatten die Europäer von den Karawanenführern (Karawanen-Bashis), die auf der großen Seidenstraße Waren aus China transportierten, von den geheimnisvollen Tataren gehört, die in den östlichen Ländern lebten. Da die Chinesen fast alle nördlich des Reichs der Mitte lebenden Völker, einschließlich der Mongolen und Jakuten, als Tataren bezeichneten, entstand im Westen die Vorstellung, dass die Tartarei eine riesige Macht war, die fast ganz Asien einnahm.
Im 13. Jahrhundert, nach den Überfällen der Truppen des Mongolen Batu Khan auf mehrere europäische Länder, wurde die Einstellung gegenüber den Tataren negativ. Man begann, sie als furchterregende Krieger aus dem Osten zu betrachten, deren Horden eines Tages der christlichen Zivilisation ein Ende bereiten würden.
In religiösen Texten hieß es, die Tataren seien Wilde, grimmig wie Dämonen, die von Satan selbst entsandt wurden. In der griechischen Mythologie ist der Tartaros ein Abgrund, der sich unter dem Reich des Hades (der Welt der Toten) befindet.
Aufgrund der Ähnlichkeit des Ethnonyms Tataren mit dem Namen der heidnischen Hölle in Westeuropa glaubte man, dass die Große Tartarei ein Land sei, in dem verschiedene Monster und Kreaturen lebten, darunter die legendären Gog und Magog, und dass die Menschen dort den Antichristen anbeten. Man glaubte, dass die Quelle des Flusses, der durch dieses Gebiet fließt, in einer jenseitigen Dimension liegt. Einige westeuropäische Forscher hielten die Große Tartarei für ein riesiges Reich, das sich vom Ural bis zum Pazifischen Ozean erstreckt. So schrieb beispielsweise der italienische Diplomat und Jesuit Giovanni Botero in seinem Werk „Le relationi universali“ [dt.: „Universelle Beziehungen“; Anm. d. Übers.] aus dem Jahr 1595, dass dieses Land früher Skythien genannt wurde. Es nehme halb Asien ein und grenze im Westen an die Wolgaregion und im Süden an China und Indien. Gleichzeitig würden die Länder des riesigen Reichs von den Wassern des Kaspischen Meeres auf der einen und des Beringmeeres auf der anderen Seite umgeben.
Ein weiterer Vertreter des Jesuitenordens, der französische Orientalist Jean-Baptiste Du Halde, veröffentlichte 1735 ein wissenschaftliches Werk, das 1747 auf Deutsch unter dem Titel „Ausführliche Beschreibung des Chinesischen Reichs und der grossen Tartarey“ erschien. Seiner Meinung nach grenzte dieses riesige Land im Westen an Moskowien, im Süden an die Mongolei und China, im Norden dieses Staates befand sich das Nordpolarmeer und im Osten das Ostchinesische Meer, das die Tartarei von Japan trennt. Und 1659 wurde in London ein Anhang zu „Opus de Doctrina Temporum“ veröffentlicht, dem Werk des französischen Kardinals Dionysius Petavius (Denis Pétau), das der Geografie gewidmet ist. Darin heißt es, dass der Fluss Tartarus den größten Teil des riesigen Reichs bewässert. Dem Kardinal zufolge wird die Große Tartarei im Westen durch den Ural und im Süden durch den Ganges begrenzt. Die Küste des gefrorenen Ozeans befindet sich im Norden des Landes, und die Gewässer des „Qing-Meeres“ 1 umspülen dieses Gebiet von Osten her.
Allerdings waren nicht alle Wissenschaftler geneigt, der Großen Tartarei so große Flächen zuzuweisen. Einige Geografen verorteten dieses Land in Zentralasien. So heißt es in der „Encyclopedia Britannica“ (Band 3, 1773), der Staat Tartarus liege südlich von Sibirien, nördlich von Indien und Persien und westlich von China.

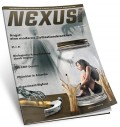
 Feuerspeiende Drachen, hundsköpfige Gestalten, Flugmaschinen und freie Energie – was soll es nicht alles gegeben haben in diesem Reich zwischen Mythos und Realität, das in alten Karten als Große Tartarei gekennzeichnet ist. Der Forscher Paul Stonehill, der lange in Russland gelebt hat, entschlüsselt die historischen Ursprünge des Tartarien-Mythos. Er zeichnet nach, wie aus einem vagen geografischen Konzept ein angebliches Großreich wurde, das schließlich im 18. oder 19. Jahrhundert von den Karten verschwand. Dafür gab es Gründe – allerdings sind die um einiges nüchterner, als manch sensationalistische moderne Mythen vermuten lassen.
Feuerspeiende Drachen, hundsköpfige Gestalten, Flugmaschinen und freie Energie – was soll es nicht alles gegeben haben in diesem Reich zwischen Mythos und Realität, das in alten Karten als Große Tartarei gekennzeichnet ist. Der Forscher Paul Stonehill, der lange in Russland gelebt hat, entschlüsselt die historischen Ursprünge des Tartarien-Mythos. Er zeichnet nach, wie aus einem vagen geografischen Konzept ein angebliches Großreich wurde, das schließlich im 18. oder 19. Jahrhundert von den Karten verschwand. Dafür gab es Gründe – allerdings sind die um einiges nüchterner, als manch sensationalistische moderne Mythen vermuten lassen.
Kommentar schreiben